Ein Gastbeitrag von RA Kai-Friedrich Niermann, KFN+ Law Office
Dieser Beitrag knüpft an „Cannabis ist nicht gleich Cannabis“ vom Montag, den 3. Juni 2024
Da es zuletzt erneut zu unterschiedlichen Auffassungen zur Definition von Stecklingen gekommen ist, insbesondere auch aus der juristischen Wissenschaft, soll an dieser Stelle nochmals auf die Problematik eingegangen werden. Zumindest bezüglich der Cannabissamen herrscht zunehmend Klarheit, hatte doch eine Sprecherin des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) bestätigt, dass der gewerbliche Samenhandel in Deutschland erlaubt sei.
Auslegung des Begriffes „Cannabis“
Cannabissamen und Cannabis-Stecklinge werden nicht von den völkerrechtlichen Vereinbarungen über Betäubungsmittel erfasst, und sind damit nicht regulierte Stoffe. Diese Erkenntnisse setzt auch das KCanG um, in dem es die sowohl die Samen vom Anwendungsbereich des KCanG ausnimmt als auch die Stecklinge. Bei den Samen besteht insoweit eine Einschränkung, als dass der Umgang mit ihnen nur für den erlaubten eigenen und gemeinschaftlichen Eigenanbau verwendet werden dürfen.
Die Gesetzesbegründung in der BT-Drucksache 20/8704 (Seite 91 zu § 1 Nummer 6, und Seite 101 zu § 9 Abs. 1), nach der auch Stecklinge bzw. die ungeerntete Cannabispflanze ohne Blütenstand als Cannabis im Sinne des Gesetzes gelten sollen, ist nicht vertretbar, und kann auch nicht nachvollzogen werden, da sich diese Aussage klar gegen den Wortlaut von §1 Nr. K KCanG stellt. Eine entsprechende Auslegung des Gesetzes ist mit dem juristischen Auslegungskanon in grammatikalischer, teleologischer, systematischer, und historischer Hinsicht nicht zu vereinen. Darüber hinaus sind einzelne Sätze in einer Gesetzesbegründung im Rahmen der historischen Auslegung nicht bindend, wie zuletzt der Bundesgerichtshof nochmal klargestellt hat, sondern allenfalls ein Indiz, dass insgesamt mit der vollständigen Gesetzesbegründung und mit den anderen Auslegungsmethoden zu gewichten ist.
Der Wortlaut der Definition der Stecklinge ist insoweit eindeutig. Solange kein Blüten- oder Fruchtstand vorhanden ist, ist ein Steckling Vermehrungsmaterial im Sinne des Gesetzes, und Vermehrungsmaterial ist ausdrücklich von der Definition von Cannabis ausgenommen. Das Gesetz kennt keine weiteren Tatbestandsmerkmale, die für die Abgrenzung herangezogen werden könnten, wie zum Beispiel die Größe oder das Alter der Pflanze.
Auch systematisch spricht alles dafür, die Stecklinge von der Definition Cannabis auszunehmen. Es macht keinen Sinn, wenn nur 3 Pflanzen angebaut werden dürfen, Anbauvereinigungen aber insgesamt bis zu 5 Stecklinge oder bis zu 7 Samen an ihre Mitglieder abgeben dürfen. Wenn alle 5 Stecklinge am Wohnsitz des Einzelnen weiterentwickelt werden, würde die zulässige Pflanzenzahl überschritten werden, obwohl noch kein Blütenstand vorhanden ist. Dann würde eine Strafbarkeit gemäß § 34 Abs. 1 Nr. 2a KCanG in dem Moment eintreten, in dem die 5 Stecklinge übergeben werden.
Zuletzt hatte sich Patzak (Patzak/Fabricius/Patzak, 11. Aufl. 2024, KCanG § 1 Rn. 8) zu der Problematik in der neuen Kommentierung zum KCanG geäußert. Patzak nimmt die zitierten Ausführungen in der Gesetzesbegründung auf und stellt fest:
„Stecklinge werden mit dem Einpflanzen zum Setzling (BT-Drs. 20/8704, 89) und unterfallen dann dem Cannabisbegriff des § 1 Nr. 8 KCanG. Stecklinge unterscheiden sich also von Cannabispflanzen iSd § 1 Nr. 8 KCanG dadurch, dass sie noch nicht eingepflanzt sind.
Der Begriff „Setzling“ wird vom KCanG an keiner Stelle im Gesetzestext verwendet. Der Begriff taucht erst in der Gesetzesbegründung auf, und sorgt an dieser Stelle deshalb für die entsprechende Verwirrung. Wenn es richtig wäre, dass ein Steckling mit dem Einpflanzen zum Setzling wird, was man sprachlich und biologisch noch vertreten kann, aber damit auch gleichzeitig zu Cannabis im Sinne des § 1 Nummer 8 KCanG, könnten Stecklinge niemals an Endkonsumenten abgegeben werden. Denn, sobald der Steckling von der Mutterpflanze abgeschnitten wird, benötigt er ein Pflanzmedium, in das er dann „eingepflanzt“ werden muss, ansonsten stirbt er ab.
Nach dieser Auffassung wäre dann eine Mutterpflanzenproduktion möglich, da noch keine Fruchtstände vorliegen und der Steckling noch nicht abgeschnitten und eingepflanzt ist. Die abgeschnittenen Stecklinge würden dann aber umgehend zu Cannabis, sobald sie in ein übliches Pflanzmedium eingesetzt werden. Und zwar unabhängig davon, ob der gewerbliche Händler den Steckling nach dem Abschneiden einpflanzt, oder erst derjenige, der den Steckling zuhause in das finale Pflanzmedium einsetzt.
Das widerspricht dem klaren Willen des Gesetzeswortlautes, der die Unterscheidung zu Jungpflanzen bzw. Stecklingen und Setzlingen nicht kennt, und der ebenso regelt, dass gemäß § 20 Abs. 3 KCanG fünf Stecklinge gleichzeitig an Mitglieder von Anbauvereinigungen oder Dritte übergeben werden können. Es ist nicht überraschend, dass Patzak in seiner Kommentierung zu § 20 Abs. 3 KCanG hierfür keine Erklärung findet, und diesen offensichtlichen Widerspruch zu seiner Kommentierung zu § 1 Nr. 8 gar nicht erst thematisiert.
Der Entwurf des Cannabiskontrollgesetzes der Grünen sah in § 5 Abs. 2 ebenfalls die Erlaubnis vor, bis zu drei weibliche, blühende Cannabispflanzen für den persönlichen Eigenanbau anpflanzen zu dürfen.
Blühend oder lebend?
In der Konsequenz laufen beide Regelungen auf dasselbe rechtliche Ergebnis hinaus. Erst wenn die Pflanze in die Blütephase eintritt, ist es Cannabis, und erst dann tritt der rechtlich relevante Zeitpunkt ein, in dem die Beschränkung auf die Pflanzenanzahl relevant wird. Davor kann der Einzelne entscheiden, ob die Genetik sich gut entwickelt hat und für eine ertragreiche Blütephase geeignet ist, oder vor Erreichen der Blütephase vernichtet werden muss.
Eine ähnliche Rechtslage gilt in Österreich. Stecklinge sind nach dem österreichischen Suchtmittelgesetz nicht verboten, bzw. besteht kein generelles Anbau- und Aufzuchtverbot. „Illegales Suchtgift“ liegt nach dem Suchtmittelgesetz erst dann vor, wenn eine Trennung der „suchtgifthaltigen“ Teile (Blüten, Fruchtstände, Harz) von der Pflanze erfolgt. Der Anbau ist natürlich auch in Österreich insofern verboten, als damit rauschfähiges Blütenmaterial hergestellt werden soll. Aber vom Grundsatz her gilt auch in Österreich die Einstufung der Single Convention, dass Samen und Stecklinge keine kontrollierten Stoffe sind.
Auch bei der teleologischen Auslegung ergibt sich kein anderes Ergebnis. Insbesondere die Erwähnung der juristischen Personen in § 26 Abs. 1 Nummer 1 KCanG, die Vermehrungsmaterial an Anbauvereinigungen liefern sollen, spricht eindeutig dafür, dass eine kommerzielle Lieferkette für Vermehrungsmaterial vom Gesetzgeber gewünscht ist. In der Gesetzesbegründung werden die gewerblichen Anbieter ebenfalls ausdrücklich erwähnt. An keiner Stelle des Gesetzes wird ausgeschlossen, dass Vermehrungsmaterial an Konsumenten nicht durch gewerbliche Händler in Deutschland abgegeben werden können. Die Pflicht zur Dokumentation der Lieferungen gewerblicher Händler seitens der Anbauvereinigungen wurde aufgenommen, um sicherstellen zu können, dass keine Versorgung aus dem Schwarzmarkt erfolgt.
Risikobeurteilung und Schutzgut
Darüber hinaus ist es gerade Ziel des Gesetzes, den Eigenanbau als Teil der Strategie zur Bekämpfung des illegalen Marktes zu erlauben. Soll dieses Ziel erreicht werden, muss auch ausreichend Vermehrungsmaterial für Konsumentinnen und Konsumenten zur Verfügung stehen. Eine gewerbliche Lieferkette bietet in der Regel hierfür die besten Voraussetzungen. Es besteht deshalb keine Veranlassung, insbesondere nicht aus rechts- oder gesundheitspolitischen Gründen, hier eine strengere Auslegung vorzunehmen, und damit vom Willen des Gesetzeswortlaut in sprachlicher und inhaltlicher Hinsicht abzuweichen. Die geänderte Risikobeurteilung für Cannabis und das neu zu bewertende Schutzgut des KCanG sind ebenfalls zu berücksichtigen.
Cannabissamen und Cannabis-Stecklinge sind daher kein Cannabis im Sinne von § 1 Nr. 8 KCanG. Sie unterliegen deshalb nicht den beschränkenden Regulierungen des KCanG und können deshalb in Deutschland gehandelt werden, und von Endverbrauchern auch in Deutschland erworben werden, sofern die Samen zuvor aus dem EU-Ausland importiert wurden.
Stecklingsproduktion?
Da Cannabis, wie zuvor erläutert, erst bei Blüten- oder Fruchtständen als Cannabis definiert wird, kann auch die Produktion von Stecklingen in Deutschland stattfinden, da die Mutterpflanze solche Blüten- oder Fruchtstände nicht aufweist. Vielmehr ist die Mutterpflanze die Pflanze, die die Jungpflanzen oder Sprossteile im Sinne von § 1 Nr. 6 KCanG erst erzeugt, die dann zu Anzucht von Cannabispflanzen verwendet werden sollen. Sie ist damit im Sinne des Gesetzes ebenfalls zur Anzucht von Cannabispflanzen bestimmt, § 1 Nummer 6 KCanG. Es ist keine rechtliche Argumentation ersichtlich, warum eine Mutterpflanzenproduktion unter den Begriff von Cannabis im Sinne der Nummer 8 des § 1 KCanG fallen sollte.
Bei einem anderen Verständnis wäre auch nur der Import von Stecklingen möglich, was der deutschen Cannabisindustrie ohne rechtliches Erfordernis erhebliche Chancen und Optionen nehmen würde.
Bestimmtheitsgebot
Gemäß Art. 103 Abs. 2 Grundgesetz gilt im Strafrecht der Bestimmtheitsgrundsatz. Danach kann eine Tat nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. Die Abgrenzung von unregulierten Vermehrungsmaterial zu reguliertem Cannabis im Sinne des Gesetzes ist durch die Übernahme der internationalen Definition für Cannabis einfach möglich (Blütenstand oder Fruchtstand: ja oder nein?). Bei einer konsequenten Anwendung dieser Definition wird dem strafrechtlichen Bestimmtheitsgebot ausreichend Rechnung getragen. Raum für abweichende Interpretationen zu anderen Tatbestandsmerkmalen besteht nicht, und ist anhand der klaren Definition auch nicht erforderlich.
Dasselbe gilt für Stecklinge, die bereits eine gewisse Größe erreicht haben. Photoperiodische Genetiken reagieren auf den Lichtzyklus. Werden diese Genetiken sowohl 12 Stunden beleuchtet als auch 12 Stunden in Dunkelheit gehalten, kann die Pflanze „in die Blüte geschickt“ werden. Bei einem Outdooranbau passiert dieser Vorgang automatisch ab August, da die Lichtverhältnisse in unseren Breitengraden dann dem oben genannten Verhältnis entsprechen.
Allerdings wird sich dann immer noch eine Blütephase von 6-8 Wochen anschließen. Bis zu diesem Zeitpunkt können die Jungpflanzen allerdings auch Höhen von bis zu 70cm und mehr erreicht haben. Trotzdem handelt es sich immer noch um Jungpflanzen, da erst die Blütephase den letzten Lebenszyklus der Pflanze einleitet und insofern die klare Abgrenzung des Gesetzes auch insofern allein entscheidend ist.
Ergebnis
Bei der rechtlichen Behandlung von Stecklingen sollte man sich ausschließlich auf die internationale Definition konzentrieren. Weder aus gesundheitspolitischen noch aus rechtspolitischen Gründen ist es erforderlich, eine über den Wortlaut des KCanG hinausgehende, restriktive Auslegung vorzunehmen und anzuwenden. Ansonsten droht wie bei den CBD-Blüten eine jahrelange Rechtsunsicherheit, hunderte Strafverfahren bis zu einer eventuellen BGH-Entscheidung, und die vorsichtige, wirtschaftliche Dynamik, die sich durch die Gesetzesänderung am 1.4.2024 ergeben hat, würde unweigerlich wieder erstickt werden.
Disclaimer: Keine Rechtsberatung. Gastbeiträge müssen nicht die Meinung der Redaktion widerspiegeln.

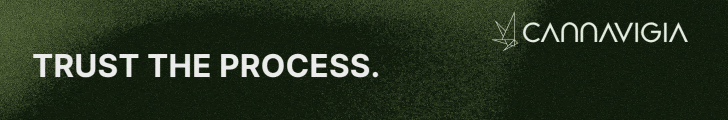

1 comment
Vielen Dank für diesen Kommentar, den wir gerne weiterverbreiten / bei uns verlinken. Es deckt sich mit unserer Interpretation der Absichten des Gesetzgebers. Bleibt zu hoffen, dass man diese Rechtsauffassung nicht erst einklagen muss.
Comments are closed.