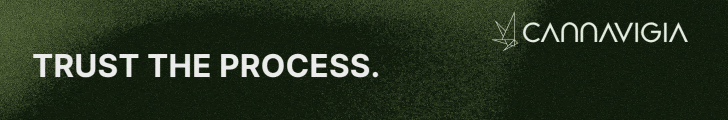Ein Gastbeitrag von Olivia Ewenike
Seit dem 1. Juli 2024 ist in Deutschland der gemeinschaftliche Anbau in sogenannten Anbauvereinigungen und die Weitergabe von Cannabis an die Mitglieder dieser Anbauvereinigungen zum privaten Eigenkonsum möglich. Anbauvereinigungen, auch bekannt als Cannabis Clubs oder Anbauvereine, können ab diesem Datum offiziell Anträge für Anbaulizenzen stellen. Die nachgelagert in Kraft getretenen Regelungen des Konsumcannabisgesetzes („KCanG“) markieren einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung einer progressiven Drogenpolitik und einem regulierten und kontrollierten Cannabismarkt in Deutschland. Konsument:innen haben nunmehr die Möglichkeit über eine Mitgliedschaft in einem Cannabis Club, Cannabis zu beziehen und müssen sich nicht mehr durch privaten Eigenanbau oder den Schwarzmarkt versorgen.
Anbauvereinigungen stellen daher einen wichtigen Baustein im Zuge der kontrollierten Cannabislegalisierung dar. Die Erlaubnisantragsverfahren zeigen jedoch, dass Cannabis Clubs landesweit durch bürokratische Hürden Steine in den Weg gelegt werden. So sind beispielsweise die im Antragsverfahren für den Erwerb einer Anbauerlaubnis geforderten Angaben und Nachweise im KCanG geregelt, die inhaltlichen Voraussetzungen sind jedoch keineswegs ausreichend beschrieben. Es verbleibt den zuständigen Behörden ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Bewertung der eingereichten Unterlagen. Auch durch zusätzlich geforderte und ebenso wenig inhaltlich beschriebene Konzepte in den jeweiligen Bundesländern werden den Anbauvereinigungen zusätzliche Antragsvoraussetzungen aufgebürdet, deren Sinnhaftigkeit man in Frage stellen darf. So wird es in der Praxis am Ende ohnehin nicht auf die im Voraus in etwaigen Konzepten mitgeteilten Absichtsbekundungen der Cannabis Clubs ankommen, sondern auf deren Umsetzung und Effektivität, die es vor allem nachträglich zu kontrollieren gilt. Die Existenz der Anbauvereinigungen durch zu hohe Anforderungen oder langwierige Antragsverfahren zu verzögern, spielt am Ende nur dem Schwarzmarkt in die Tasche – der bekanntlich über keinerlei Konzepte zur Qualitätssicherung oder zum Kinder- und Jugendschutz etc. verfügt.
Um den Antragsprozess für Anbauvereinigungen etwas zu vereinfachen, wird im Folgenden dargestellt, welche Voraussetzungen für die Anbaulizenz erfüllt und welche Unterlagen eingereicht werden müssen.
Antragstellung und Form
Eine Anbauerlaubnis wird nur auf Antrag erteilt. Das bedeutet, dass die Anbauvereinigung aktiv bei der zuständigen Behörde einen Antrag stellen muss, um die Genehmigung zu erhalten. Dabei ist zu beachten, dass die Anbauvereinigung vor der Antragsstellung zunächst als eingetragener nicht wirtschaftliche Verein nach § 21 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) eingetragen werden muss.
Der Antrag kann entweder schriftlich oder elektronisch bei der zuständigen Behörde eingereicht werden. Eine einfache E-Mail reicht hierfür oft aus. Dennoch ist es ratsam, bei der zuständigen Behörde über die genauen Anforderungen und das Verfahren Informationen einzuholen, da einige Bundesländer spezifische Online-Verfahren für die Antragsstellung eingeführt haben.
Erforderliche Angaben im Antrag
Der Erlaubnisantrag für eine Anbaulizenz erfordert umfassende Angaben. Es gibt bestimmte Angaben, die nach dem KCanG in jedem Bundesland verpflichtend mitzuteilen sind, während die Länder auch zusätzliche Anforderungen stellen können.
Mithin ist zu unterscheiden zwischen den gesetzlich vorgesehenen Angaben und Nachweisen nach § 11 Abs. 4 KCanG und den zusätzlichen Angaben und Nachweisen zur Sicherstellung der Gewährleistung der Einhaltung der sonstigen Vorgaben des KCanG und der aufgrund des KCanG erlassenen Vorschriften für Anbauvereinigungen nach § 11 Abs. 3 Nr. 3 KCanG.
Gesetzlich vorgesehene Angaben und Nachweise nach § 11 Abs. 4 KCanG
Folgende Angaben und Nachweise sind gesetzlich vorgeschrieben und müssen in jedem Bundesland mit der Antragsstellung eingereicht werden.
- Allgemeine Angaben der Anbauvereinigung: Name, Rechtsform, Telefonnummer, elektronische Kontaktdaten und Anschrift des Sitzes der Anbauvereinigung. Gegebenenfalls werden auch die geplanten Geschäftszeiten abgefragt. Zudem ist oftmals eine Kopie der Satzung einzureichen.
- Zuständiges Registergericht und Registernummer: Angaben zum zuständigen Registergericht und der Registernummer der Anbauvereinigung.
- Angaben zu Vorstandsmitgliedern und vertretungsberechtigten Personen: Vornamen, Nachnamen, Geburtsdaten, Anschriften und elektronische Kontaktdaten aller Vorstandsmitglieder und vertretungsberechtigten Personen. Auch muss oftmals die Mitgliedschaft in der Anbauvereinigung nachgewiesen werden.
- Angaben zu entgeltlich Beschäftigten: Vornamen, Nachnamen, Geburtsdaten, Anschriften und elektronische Kontaktdaten aller entgeltlich Beschäftigten, die Zugang zu Cannabis und Vermehrungsmaterial haben. Dies umfasst lediglich geringfügig Beschäftigte (Mini-Jobber) und keine ehrenamtlich tätigen Mitglieder.
- Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister: Ein höchstens drei Monate vor der Antragstellung ausgestelltes Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde und eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister sind erforderlich. Diese Dokumente müssen für jedes Vorstandsmitglied sowie für jede sonstige vertretungsberechtigte Person der Anbauvereinigung vorgelegt werden.
- Geschätzte zukünftige Zahl der Mitglieder: Die geschätzte zukünftige Zahl der Mitglieder der Anbauvereinigung muss angegeben werden, um sicherzustellen, dass die zulässige Mitgliederzahl von höchstens 500 Mitgliedern nicht überschritten wird.
- Lage des befriedeten Besitztums: Genaue Lage des befriedeten Besitztums der Anbauvereinigung, einschließlich Ort, Straße, Hausnummer und gegebenenfalls Flurbezeichnung. Eine präzise Beschreibung in einem Lageplan kann hilfreich sein.
- Größe der Anbauflächen und Gewächshäuser: Angaben zur genauen Größe der Anbauflächen und Gewächshäuser in Hektar oder Quadratmetern.
- Geschätzte Mengenangaben für Marihuana und Haschisch: Die Mengen an Cannabis, die pro Jahr angebaut und an die Mitglieder weitergegeben werden sollen, müssen getrennt nach Marihuana und Haschisch angegeben werden.
- Konzept über die Sicherungs- und Schutzmaßnahmen: Beschreibung des Konzepts über die getroffenen oder voraussichtlichen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen des befriedeten Besitztums (§ 22 Abs. 1 KCanG), um sicherzustellen, dass Cannabis und Vermehrungsmaterial gegen den Zugriff unbefugter Dritter sowie gegen Kinder und Jugendliche gesichert sind. Die Anforderungen an das Konzept können sich dabei je nach Erlaubnisbehörde stark unterscheiden.
- Angaben zum Präventionsbeauftragten: Name, Geburtsdatum, Anschrift und elektronische Kontaktdaten des/der Präventionsbeauftragten sowie ein Nachweis des/der Präventionsbeauftragten über die Teilnahme an Suchtpräventionsschulungen bei Landes- oder Fachstellen für Suchtprävention oder Suchtberatung oder bei vergleichbar qualifizierten öffentlich geförderten Einrichtungen zur Erlangung von Beratungs- und Präventionskenntnissen (§ 23 Absatz 4 Satz 5 KCanG). Dieser Nachweis kann innerhalb von drei Monaten nach Antragsstellung noch nachgereicht werden.
- Gesundheits- und Jugendschutzkonzept: Ein Konzept, das die vorgesehenen Maßnahmen für den Gesundheits- und Jugendschutz sowie die Suchtprävention enthält. Darin sollen geeignete Maßnahmen zur Erreichung eines umfassenden Jugend- und Gesundheitsschutzes in der Anbauvereinigung insbesondere zu einem risikoreduzierten Konsum von Cannabis sowie zur Suchtprävention, dargelegt werden. Auch hier sind die landesspezifischen Anforderungen an das Konzept zu beachten.
Zusätzliche Angaben zur Sicherstellung der Gewährleistung der Einhaltung der rechtlichen Anforderungen (§ 11 Abs. 3 KCanG)
Weiterhin können Behörden zusätzliche Angaben und Nachweise zur Sicherstellung der Gewährleistung der Einhaltung der sonstigen Vorgaben des KCanG und der aufgrund des KCanG erlassenen Vorschriften für Anbauvereinigungen nach § 11 Abs. 3 Nr. 3 KCanG anfordern.
- Weitere Angaben zu vertretungsberechtigten Personen: Einige Behörden verlangen eine Versicherung, dass die vertretungsberechtigten Personen unbeschränkt geschäftsfähig sind.
- Weitere Angaben zur Lage des befriedeten Besitztums: Oftmals muss die Anbauvereinigung versichern, dass sich das befriedete Besitztum nicht innerhalb eines Radius von 200 Metern um Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen oder Kinderspielplätzen befindet. Ebenso muss bestätigt werden, dass das befriedete Besitztum weder vollständig noch teilweise innerhalb einer privaten Wohnung oder eines militärischen Bereiches liegt. Einige Bundesländer fordern Angaben zu einem baulichen Verbund mit Anbauflächen oder Gewächshäusern anderer Anbauvereinigungen in einem gemeinsamen Gebäude oder Gebäudekomplex bzw. in unmittelbarer räumlicher Nähe von Anbauflächen oder Gewächshäusern anderer Anbauvereinigungen.
- Angaben zu den sonstigen entgeltlich Beschäftigten: Einige Bundesländer fordern eine Liste aller geringfügig entgeltlich Beschäftigten oder anderer Nichtmitglieder, die nicht direkt an Tätigkeiten beteiligt sind, die den Anbau oder die Weitergabe von Cannabis und Vermehrungsmaterial betreffen. Diese Liste soll Namen, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, Funktion und E-Mail-Adresse dieser Personen enthalten, um die Einhaltung des Verbots der Doppeltätigkeit aus § 17 Abs. 1 S. 4 KCanG zu überwachen.
- Mitwirkungskonzept: Nur Bayern fordert ein Mitwirkungskonzept zur Aufgabenverteilung innerhalb der Anbaugemeinschaft, um zu gewährleisten, dass die Mitglieder aktiv am gemeinschaftlichen Anbau von Cannabis mitwirken.
- Probenentnahmekonzept zur Qualitätssicherung: Mehr als die Hälfte aller Bundesländer fordern ein Konzept zur Qualitätssicherung, um die Qualität des angebauten Cannabis sowie des gewonnenen und erworbenen Vermehrungsmaterials durch regelmäßige Stichproben zu überprüfen.
- Konzept zur Vernichtung von nicht weitergabefähigem Cannabis: Auch wird oft ein Konzept zur sicheren Entsorgung von nicht mehr brauchbarem Cannabis und Vermehrungsmaterial gefordert, um Missbrauch und illegalen Handel zu verhindern.
- Transportkonzept: Andere Bundesländer fordern zudem ein Konzept, das die getroffenen oder geplanten Sicherungs- und Schutzmaßnahmen für den Transport von Cannabis und Vermehrungsmaterial beschreibt.
- Sichtschutzkonzept: Teilweise wird ein gesondertes Sichtschutzkonzept gefordert, damit sichergestellt wird, dass die Anbauflächen und Gewächshäuser nicht von außen eingesehen werden können.
- Konzept für Produktwarnung und Produktrückruf: Wenige Bundesländer fordern hingegen ein Konzept für den Fall eines angeordneten Rückrufs oder der Rücknahme des angebauten oder weitergegebenen Cannabis oder des erhaltenen Vermehrungsmaterials.
- Dokumentationspflichten: Ein Muster für die erforderlichen Dokumentationspflichten über Erwerb, Bestand und Verbleib von Cannabis und Vermehrungsmaterial ist in einigen Bundesländern auch Pflichtnachweis.
- Weitere Informationen und Angaben: Vereinzelt fordern Bundesländer weitere Informationen, wie zu dem geplante gemeinschaftlichen Cannabis-Anbau. Baden-Württemberg fordert zudem auch weitere Informationen zu der Kalkulation der Mitgliedsbeiträge sowie zu Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Nachbarschaftsschutz.
Aktuelle Statistik zur Antragstellung
Obwohl die Anträge ab dem 1. Juli 2024 eingereicht werden können, wird es einige Zeit dauern, bis der tatsächliche Anbau beginnt. Die Prüfung und Genehmigung der Anträge können Wochen bis Monate in Anspruch nehmen. Erste Schätzungen gehen davon aus, dass die Anbauphase frühestens im Herbst 2024 starten könnte, möglicherweise jedoch erst Anfang 2025.
Die ersten Statistiken zur Antragstellung zeigen ein unterschiedliches Bild in den einzelnen Bundesländern. Dabei wurden in Niedersachsen 20 Anträge zur Genehmigung des Betriebs einer Anbauvereinigung eingereicht – sieben davon wurden befürwortet, sechs abgewiesen.
In Baden-Württemberg wurden bis Anfang August 38 Anträge eingereicht, ohne dass bisher Entscheidungen getroffen wurden. In Hessen sind einen Monat nach dem Start neun Anträge auf Zulassung eingegangen. In Rheinland-Pfalz wurden 13 Anträge eingereicht, die derzeit geprüft werden. In Hamburg wurden sieben Anträge gestellt und in Schleswig-Holstein bisher vier. Allen voran sind in Nordrhein-Westfalen seit Anfang Juli knapp 43 Anträge auf eine Erlaubnis für den gemeinschaftlichen Cannabis-Eigenanbau und seine Weitergabe in Anbauvereinigungen gestellt worden. Keiner der Anträge wurde allerdings bisher verbeschieden.
Fazit
Die Beantragung einer Anbaulizenz für Cannabis Clubs sollte sorgfältig vorbereitet werden. Cannabis Clubs müssen viele Anforderungen erfüllen, um erfolgreich eine Lizenz zu erhalten. Eine vorschnelle Antragsstellung, beispielsweise mit von ChatGPT erstellten Konzepten, wird in den meisten Fällen nicht ausreichend sein und zur Ablehnung oder Monierung des Antrags führen. Teilweise sind die von ChatGPT erstellten Konzepte auch zu weitreichend und werden später bei der Realisierung den Clubbetreiber:innen erhebliche Kosten oder Umsetzungsschwierigkeiten verursachen.
Allen antragstellenden Vereinen ist zu empfehlen, sich über die spezifischen gesetzlichen Vorgaben in ihrem jeweiligen Bundesland zu informieren und sich bei der Konzepterstellung von Expert:innen beraten zu lassen. Ein ordentlich vorbereiteter Antrag wird schließlich nicht nur die Chancen auf den Erhalt einer Anbaulizenz erhöhen, sondern auch dazu beitragen, diese in der Folgezeit behalten zu dürfen.
Über die Autorin
Olivia Ewenike hat sich als renommierte Expertin im Bereich des Betäubungsmittelstrafrechts und speziell des Cannabisrechts etabliert. Sie führt eine eigene Kanzlei im Herzen von München und berät nationale und internationale Unternehmen sowie Anbauvereinigungen mit einem besonderen Augenmerk auf das Konsumcannabisgesetz. Neben ihrer Rolle als Strafverteidigerin ist Olivia auch Mitgründerin der Lito Law Academy GmbH. In dieser Funktion berät sie Cannabis-Clubs bei der Gründung, dem Erlaubnisantragsprozess und dem rechtskonformen Betrieb in Deutschland, um sicherzustellen, dass diese im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben agieren. Ihr fundiertes Wissen fließt in die Unterstützung dieser Vereinigungen ein, um deren rechtssicheren Betrieb zu gewährleisten. Darüber hinaus bietet sie umfangreiche Beratungsdienste für Unternehmen an, die sich auf dem komplexen und wachsenden Cannabismarkt in Deutschland erfolgreich positionieren wollen.
Disclaimer: Gastbeiträge müssen nicht die Meinung der Redaktion widerspiegeln.