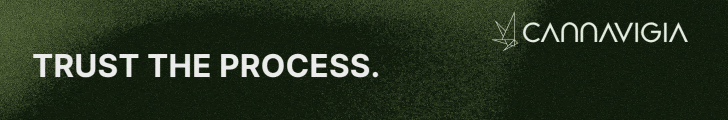Ein Gastbeitrag von Daniel Haymann und Lukas Brunner
Ende August 2025 hat die Sozial- und Gesundheitskommission des Nationalrates (SGK-N) den Vorentwurf des Cannabisproduktegesetzes in die Vernehmlassung geschickt. Damit startet das ordentliche Konsultationsverfahren: Kantone, Parteien, Verbände, Fachkreise und weitere interessierte Kreise können Stellung nehmen. Die Frist läuft bis zum 1. Dezember 2025. Grundlage sind der Vorentwurf und ein ausführlicher erläuternder Bericht. Nach Abschluss der Vernehmlassung wertet die Kommission die Eingaben aus, bereinigt den Text und übermittelt den Entwurf dem Bundesrat zur Stellungnahme. Danach gelangt die Vorlage zusammen mit dem Bericht der Kommission und der Stellungnahme des Bundesrates in die parlamentarische Beratung.
Die vorliegende Schweizer Vorlage ist in ihrer Tiefe und Kohärenz europaweit herausragend. Sie verbindet Gesundheitsschutz, Qualitätssicherung und klare Aufsicht mit einem praxistauglichen Marktaufbau und stützt sich auf eine ungewöhnlich gründliche Vorbereitung. Die SGK-N hat den Prozess über Jahre geführt und das Bundesamt für Gesundheit, weitere Bundesstellen und externe Expertise eng einbezogen. Dazu gehören eine Regulierungsfolgeabschätzung, wirtschaftliche Varianten zur Lenkungsabgabe sowie verfassungsrechtliche, völkerrechtliche und handelsrechtliche Gutachten. Die Vorlage übernimmt bewusst Erkenntnisse aus den Pilotversuchen und überführt diese in ein landesweites Regelwerk.
Die Kernpunkte im Überblick:
- Konsum, Besitz, Weitergabe
Erwachsene dürfen unentgeltlich teilen, aber nur zwischen Erwachsenen und innerhalb der zulässigen Mengen. Private Lagerung: maximal 75 g THC über alle Produkte hinweg. Öffentlicher Raum bei erworbenen Produkten: maximal 5 g THC insgesamt. Öffentlicher Raum bei Eigenanbau: maximal 30 g Blüten oder 15g Haschisch oder Extrakte. - Eigenanbau
Zuhause erlaubt bis zu drei weibliche Pflanzen in der Blütephase pro erwachsene Person. - Verkauf und Konzessionen
Kantone halten das Verkaufsrecht und begrenzen die Zahl der Konzessionen aus Gründen von Gesundheit und Sicherheit. Der Bund kann eine einzige Online-Konzession vergeben. - Geschäftsmodell und Anreize
Verkaufsstellen arbeiten nicht gewinnorientiert; Überschüsse über eine angemessene Eigenkapitalverzinsung fliessen in Prävention, Schadensminderung und Suchthilfe. Konzessionäre müssen eine einwandfreie Geschäftstätigkeit nachweisen, branchenübliche Löhne zahlen und auf Verkaufsprovisionen verzichten. - Produktion und Handel
Produktion und Verarbeitung dürfen gewinnorientiert sein. Einfuhr und Ausfuhr sind mit Bewilligung möglich. - Produktstandards, Verpackung, Information
Lückenlose Nachverfolgbarkeit von der Saat bis zum Verkauf. Neutrale Verpackung mit deutlichen Warnhinweisen; pro Verkaufseinheit maximal 5 g THC. Vorgefertigte Cannabiszigaretten benötigen Aktivkohlefilter. THC-Obergrenzen: Blüten 20 Prozent, Extrakte 60 Prozent. - Zugang und Verkaufsbedingungen
Verkauf nur an Schweizer Staatsangehörige und Personen mit Wohnsitz oder Aufenthaltsrecht in der Schweiz; keine Touristenverkäufe. Nachtverkaufsverbot von 22 bis 6 Uhr; Testkäufe durch die Behörden. Kein Verkauf von Alkohol oder Tabak in Cannabisläden. Werbung und Sponsoring sind vollständig untersagt. - Formen der Verkaufsstellen
Möglich sind städtische Stellen, Nichtregierungsorganisationen, Vereine, Apotheken sowie andere Unternehmen mit Haupttätigkeit ausserhalb von Cannabis.
Steuern zuerst: Wegweisend ist die klare Ausgestaltung der Lenkungsabgabe als Lenkungsinstrument und nicht als Fiskalquelle. Die Erträge werden an die Bevölkerung zurückverteilt, der Bundesrat soll die Sätze laufend an Marktdaten anpassen. Genau hier entscheidet sich der Erfolg. Die legale Kette braucht ausreichend Marge in Anbau, Verarbeitung, Labor und Logistik, während der Bruttopreis für Konsumentinnen und Konsumenten eng an der Realität des Schwarzmarkts liegen muss. Eine moderate Prämie für legale Qualität, korrekte Deklaration und verlässliche Sicherheit ist denkbar, alles darüber hinaus hält den illegalen Markt am Leben. Internationale Erfahrungen zeigen, dass potenzbasierte Abgaben sehr fein kalibriert werden können. New York setzte 2021 bei Blüten einen halben Cent pro Milligramm THC an, bei Konzentraten 0.8 Cent und bei Edibles 3 Cent. Diese Grössenordnung illustriert, wie tief eine Abgabe liegen kann, damit der legale Preis nicht aus der Spur gerät. Für die Schweiz bedeutet dies: tief starten, empirisch lernen, sinnvoll nachsteuern. Immerhin wird diese Notwendigkeit im erläuternden Bericht anerkannt, doch sie muss in der Praxis mit Mut umgesetzt werden, sonst vereiteln zu hohe Abgaben Sinn und Zweck der Reform.
Die Wahl eines nicht gewinnorientierten Verkaufs bringt aus gesundheitspolitischer Sicht Vorteile, birgt aber erhebliche Anreizprobleme. Ohne Gewinnmotiv kann aus Sicht der Autoren der Antrieb fehlen, effizient einzukaufen und Preise spürbar zu drücken. Die Pflicht, branchenübliche Löhne zu zahlen und keine Provisionen zu verwenden, ist richtig, verstärkt aber die Verschiebung der Marge in die oberen Etagen der Wertschöpfungskette. Sinnvoller wäre es, den Detailhandel zumindest als reguliert gewinnorientierte Variante zuzulassen und den Preis über echten Wettbewerb wirken zu lassen, flankiert durch klare Integritätsregeln gegen Kickbacks, Transparenz gegenüber der Aufsicht und harte Sanktionen bei Verstössen, aber ohne starre Preis- oder Margenvorgaben. Die Erfahrung aus legalisierten Märkten zeigt, dass der Schwarzmarkt längerfristig nur dann zurückgeht, wenn legale Anbieter preislich und hinsichtlich Verfügbarkeit konkurrenzfähig sind. Ein profitabler Schwarzmarkt braucht eine sinnvolle, legale und ebenfalls profitable Alternative – Wettbewerb ist dafür das wirksamste Korrektiv.
Zu den Potenzgrenzen ist die Begründung nachvollziehbar, aber aus Marktsicht nicht überzeugend. Der Bericht verweist auf forensische Daten, wonach der durchschnittliche THC-Gehalt beschlagnahmter Blüten zwischen 11 und 13 Prozent lag und potenteste Sorten kaum über 20 Prozent gehen. Das spiegelt die gelebte Realität im Markt nur bedingt. Angebots- und Nachfragewahrnehmung bewegen sich regelmässig über 20 Prozent, ob analytisch immer bestätigt oder nicht. Eine starre Obergrenze bei 20 Prozent für Blüten riskiert, stark konsumierende Erwachsene im illegalen Segment zu halten. Besser wäre, bei Blüten auf harte Obergrenzen zu verzichten und die Steuerung über klare Deklaration, differenzierte Lenkungsabgaben, strengere Beratung und Packungsgrenzen vorzunehmen. Für Extrakte sind zusätzliche Schutzmassnahmen eher plausibel, sollten aber so gestaltet sein, dass relevante Produktkategorien nicht vollständig aus dem legalen Angebot fallen.
Die Beschränkung des Verkaufs auf die Wohnbevölkerung und Personen mit Aufenthaltsrecht ist kein Zufall. Sie soll verhindern, dass eine liberalere Drogeninnenpolitik unbeabsichtigte Effekte auf Nachbarstaaten entfaltet. Die Schweiz ist an das Schengener Durchführungsübereinkommen gebunden und muss vermeiden, dass durch Reiseverkehr faktisch ein Export von Freizeitcannabis entsteht. Diese Schranke ist politisch unpopulär, völker- und europarechtlich aber begründbar.
Die Vorlage erlaubt sachliche Produktinformationen im Rahmen neutraler Verpackung und klarer Warnhinweise. Aus unserer Sicht geht ein vollständiges Werbeverbot jedoch zu weit, wenn der legale Kanal den Schwarzmarkt wirksam verdrängen soll. Sinnvoll wäre ein eng begrenztes System statt Totalverbot: Sachliche Information bleibt der Kern, ergänzt um ein Mindestmass an Branding und Verpackungsattraktivität ohne Jugendansprache und ohne Lifestyle-Botschaften. Erlaubt werden könnten ein kleines Markenlogo, eine zurückhaltende Farbwelt und klare Typografie zur eindeutigen Produktunterscheidung sowie behördlich geprüfte Angaben zu Herkunft, Anbauweise, Laborwerten, Terpenprofil und Risiken. Ausserhalb des Verkaufsumfelds bliebe Werbung weiterhin untersagt. Digitale Inhalte wären nur hinter Altersprüfung zulässig, mit gut sichtbaren Warnhinweisen. So entsteht kein zusätzlicher Konsumdruck, sondern bestehende Nachfrage wird gezielt in geprüfte Produkte mit transparenter Lieferkette und Beratung umgeleitet, was dem Gesundheitsschutz dient und die Verdrängung des Schwarzmarkts beschleunigt, weil erwachsene Konsumierende den legalen Kanal finden, wiedererkennen und ihm vertrauen.
Die Offenheit der Vorlage bei den Formen von Verkaufsstellen überzeugt. Möglich sind städtische Stellen, Nichtregierungsorganisationen, Vereine sowie Apotheken und andere Unternehmen, die hauptsächlich andere Produkte führen. Die Pilotversuche liefern erste Hinweise, dass Strukturen mit starkem Gesundheitsfokus funktionieren. Wichtig ist, dass die Kantone die Dichte so wählen, dass der legale Zugang bequem genug ist, um den illegalen Markt tatsächlich zu verdrängen. Die Regulierungsfolgeabschätzung weist auf eine Bandbreite von ungefähr 200 bis 400 Verkaufsstellen schweizweit hin, ergänzt durch einen leistungsfähigen Online-Kanal. Mit einer realistischen Abdeckung, einem funktionsfähigen digitalen Kanal und schlanken Betriebsauflagen lässt sich der Wechsel in den legalen Markt beschleunigen.
Die Vorlage sieht zudem eine klare Abgrenzung zum medizinischen Markt vor. Apotheken können zwar Konzessionen erhalten, doch der Freizeitverkauf ist als eigenständiger, nicht gewinnorientierter Kanal konzipiert.
Aus föderaler Sicht überzeugt die Vergabe des Verkaufsrechts an die Kantone. Sie kennen die lokalen Gegebenheiten, können die Zahl und Verteilung der Verkaufsstellen steuern, Gemeinden einbeziehen und bei Bedarf mit Nachbarkantonen gemeinsame Konzessionen erteilen. Der Bund setzt den übergeordneten Rahmen und übernimmt Aufgaben mit landesweiter Wirkung: Er definiert Standards für Qualität, Verpackung und Nachverfolgung, erhebt und justiert die Lenkungsabgabe und kann ergänzend einen Online-Kanal konzessionieren.
Die Monopolstellung des Bundes beim Online-Kanal ist aus unserer Sicht problematisch. Befürworter verweisen auf maximale Einheitlichkeit bei Altersnachweis, Mengenbegrenzungen, Beratung und Aufsicht sowie auf den subsidiären Charakter des Kanals gegenüber den Läden. Dagegen sprechen jedoch ein einzelner Ausfallpunkt mit Versorgungsrisiken, fehlender Preis- und Servicewettbewerb, geringere Innovationskraft, potenziell höhere Endpreise und eine problematische Daten- und Machtkonzentration bei einem Betreiber. Verfassungsrechtlich ist ein Monopol zwar grundsätzlich vertretbar, doch der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt die Prüfung milderer, gleich wirksamer Mittel. Aus unserer Sicht sind mehrere auf Bundesebene konzessionierte und gleich streng regulierte Online-Anbieter sinnvoller, mit identischen Vorgaben zu Registrierung, Beratung, Sortiment, Anbindung an Track-and-Trace sowie klaren Service-Levels und Transparenz zu Preisen und Lieferzeiten. Online bliebe ergänzend zum stationären Netz. Werden definierte Zielwerte nicht erreicht, könnte eine weitere Konzession ausgelöst werden. So bleiben Jugendschutz und Kontrolle gewahrt, während Resilienz, Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem illegalen Online-Angebot steigen.
Abschliessend zeigt sich, dass die Vorlage in Europa wegweisend sein kann, weil sie Erkenntnisse aus den Pilotversuchen in eine kohärente und überprüfbare Regulierung übersetzt. Sie verbindet einen nicht kommerziellen Detailhandel mit effizienter Wertschöpfung in den vorgelagerten Stufen und setzt auf Beratung, Qualitätsstandards und lückenlose Nachverfolgbarkeit. Entscheidend für den Erfolg sind realistische Lenkungsabgaben, eine ausreichende Abdeckung durch Verkaufsstellen und online sowie Regeln, die den legalen Markt nicht schwächen, sondern gegenüber dem Schwarzmarkt sichtbar machen. Dazu gehören eine kluge Konzessionspolitik, praxistaugliche Vollzugsstandards, eine tragfähige Lösung für die Anreize im Detailhandel und eine flexible, risikobasierte Steuerung der Produktpotenz, insbesondere bei Blüten. Gelingt dies, entsteht ein sicherer, transparenter und wettbewerbsfähiger legaler Markt, der Jugend und Gesundheit schützt, die Strafverfolgung entlastet und dem illegalen Angebot die Grundlage entzieht.
Die IG Hanf teilt diese Einschätzung weitgehend: Sie lehnt staatliche Monopole und einen nicht gewinnorientierten Detailhandel ab und plädiert für privatwirtschaftlich tragfähige Fachgeschäfte unter klaren Auflagen. Bei der Lenkungsabgabe verlangt sie wettbewerbsfähige, einfache Modelle. Zur Stärkung des Schweizer Marktes fordert sie eine Beschränkung von Importen. Zudem betont sie die klare Trennung vom medizinischen Markt und verlangt realistische THC-Grenzen (mindestens 25 bis 30 Prozent für Blüten, keine Obergrenze für Konzentrate).
Erfüllt die Umsetzung diese Massstäbe, hat die Reform das Potenzial, zum europäischen Referenzmodell zu werden.
Über die Autoren:
Daniel Haymann (MME) ist spezialisiert auf Gesellschafts- und Handelsrecht. Er berät Investoren, Start-ups und vertikal integrierte Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette, u.a. zu regulatorischen Fragen im Zusammenhang mit THC, CBD und anderen Cannabinoiden und psychedelischen Verbindungen, zu GMP- und GDP-Standards, Lebensmittel- und Kosmetikvorschriften sowie zu Zulassungsverfahren vor Swissmedic, dem Schweizerischen Heilmittelinstitut.
Lukas Brunner ist Generalsekretär der IG Hanf mit Fokus auf Rechtliches und Regulatorisches, Mitgliederbetreuung in Sachen Recht sowie die Erarbeitung von politischen Papieren.
Disclaimer: Gastbeiträge müssen nicht die Meinung der Redaktion widerspiegeln.