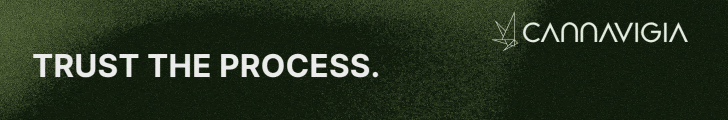Ein Gastbeitrag von Franziska Katterbach
Die Reklassifizierung von Cannabis auf UN-Ebene liegt inzwischen sechs Jahre zurück. Mit der Streichung aus Schedule IV der Einheitskonvention von 1961 hat die internationale Staatengemeinschaft – auf Grundlage wissenschaftlicher Bewertungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) – klargestellt, dass Cannabis nicht länger als Substanz ohne medizinischen Nutzen eingestuft wird. Diese Entscheidung war kein politisches Signal und keine medizinische Leitlinie, sondern eine völkerrechtlich relevante Weichenstellung: Damit wird deutlich, dass ein therapeutischer Nutzen von Cannabis auf internationaler Ebene nicht mehr verneint wird.
Damit stellt sich nicht mehr die Frage, ob Cannabis medizinischen Nutzen hat, sondern wie und in welchem Umfang diese völker- und unionsrechtliche Anerkennung tatsächlich in nationale Versorgungssysteme umgesetzt wird.
Auch die Europäische Union ist an diese Einordnung gebunden. Gleichwohl zeigt sich bis heute eine erhebliche Diskrepanz zwischen der rechtlichen Anerkennung auf internationaler Ebene und der tatsächlichen Umsetzung in den Mitgliedstaaten.
Einheitlichkeit als Grundprinzip des EU-Rechts
Gerade im Arzneimittel- und Gesundheitsrecht ist Einheitlichkeit kein politisches Wunschziel, sondern ein tragendes Strukturprinzip der Europäischen Union. Wo die EU eine gemeinsame Linie festlegt, dürfen sich Mitgliedstaaten unionsrechtlichen Vorgaben nicht selektiv entziehen – weder offen noch faktisch durch regulatorische Zurückhaltung.
Die Pflicht zur Kohärenz dient nicht allein der Formalität, sondern ist Voraussetzung für Rechtssicherheit sowie eine gleichwertige Patientenversorgung.
Dass diese Pflicht zur Kohärenz nicht bloß theoretischer Natur ist, hat der Europäische Gerichtshof jüngst in einem Verfahren gegen Ungarn verdeutlicht. Anlass war nicht die nationale Ausgestaltung des Cannabisrechts, sondern das Verhalten Ungarns bei einer internationalen Abstimmung: Der EuGH stellte klar, dass Mitgliedstaaten bei UN-Abstimmungen an gemeinsam festgelegte EU-Positionen gebunden sind und hiervon nicht einseitig abweichen dürfen. Das Urteil betrifft damit nicht die medizinische Wirkung von Cannabis, unterstreicht aber, dass unionsweite Einheitlichkeit auch nach außen verbindlich ist.
Damit zieht der EuGH klare Grenzen zulässiger nationaler Abweichungen und signalisiert, dass fragmentierte Umsetzungen die Glaubwürdigkeit der EU-Position untergraben können.
Ungarn: Anlass für eine weitergehende Frage
Vor diesem Hintergrund wirft der Fall Ungarn eine weitergehende Frage auf. Wenn bereits bei der gemeinsamen Abstimmung über die völkerrechtliche Einordnung von Cannabis von der abgestimmten EU-Linie abgewichen wird – wie belastbar ist dann die einheitliche Umsetzung dieser Einordnung auf nationaler Ebene?
Unabhängig von der konkreten Ausgestaltung einzelner nationaler Regelungen zeigt sich in mehreren Mitgliedstaaten, dass die völker- und unionsrechtliche Anerkennung des medizinischen Nutzens nicht automatisch in einen verlässlichen Patientenzugang übersetzt wird. Zwischen formaler Anerkennung und praktischer Versorgung besteht weiterhin eine spürbare Lücke. Das ist weniger ein isoliertes nationales Phänomen als vielmehr Ausdruck eines europäischen Spannungsfelds zwischen gemeinsamer Rechtsgrundlage und divergierender Umsetzung.
Deutschland: Fortschrittlich – und doch widersprüchlich
Bemerkenswert ist, dass auch in Deutschland, einem der größten Märkte für medizinisches Cannabis in Europa, der medizinische Nutzen zuletzt wieder öffentlich in Frage gestellt wurde. Dies zeigte sich unter anderem in der öffentlichen Anhörung des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages am 14. Januar 2026 zur geplanten Änderung des Medizinal-Cannabisgesetzes. Während die völker- und unionsrechtliche Anerkennung des therapeutischen Nutzens seit Jahren als geklärt gilt, wurde diese Grundlage im nationalen Gesetzgebungsverfahren relativiert.
Mehrere Sachverständige wiesen zudem darauf hin, dass eine Verschärfung der medizinischen Regulierung bei gleichzeitiger Liberalisierung des Freizeitkonsums von Cannabis den ärztlich kontrollierten Versorgungsweg faktisch schwächen könne. Die Anhörung machte damit deutlich, dass die international anerkannte Einordnung von Cannabis als Arzneimittel im nationalen Regelungssatz nicht durchgängig kohärent fortgeführt wird.
Die im Bundestag zuletzt geführte Debatte steht damit im Kontrast zur Entwicklung seit 2017, zur Umklassifizierung von Cannabis als verschreibungspflichtiges Arzneimittel und zur kontinuierlichen Ausweitung des Patientenzugangs. Sie verstärkt zugleich die Unsicherheit bei Ärzten, etwa mit Blick auf mögliche Regressansprüche der Krankenkassen, und wirkt damit faktisch versorgungshemmend.
Anerkennung ohne Umsetzung?
Sechs Jahre nach der UN-Reklassifizierung lässt sich daher festhalten:
Der medizinische Nutzen von Cannabis ist völker- und unionsrechtlich anerkannt – die Umsetzung bleibt jedoch fragmentiert.
Das EuGH-Urteil zu Ungarn erinnert daran, dass die Europäische Union kein Flickenteppich nationaler Alleingänge sein darf. Gerade im sensiblen Bereich der Gesundheitsversorgung stellt sich die Frage, wie lange eine faktische Distanz zwischen gemeinsamer rechtlicher Anerkennung und nationaler Praxis noch tragfähig ist.
Die eigentliche Debatte sollte daher nicht lauten, ob Cannabis medizinischen Nutzen hat. Diese Frage wurde wissenschaftlich geprüft und rechtlich eingeordnet. Entscheidend ist vielmehr, wann Europa beginnt, diese Anerkennung konsequent und kohärent in Versorgung zu übersetzen.
Über die Autorin
Franziska Katterbach ist eine erfahrene Rechtsberaterin im Bereich Life Sciences und Healthcare mit einem seit über zehn Jahren bestehenden Schwerpunkt auf dem entstehenden Cannabissektor. Sie berät europäische Cannabisunternehmen zu regulatorischen, kommerziellen und Compliance-Fragen. Ihre Transaktionserfahrung in Europa umfasst ein Volumen im hohen dreistelligen Millionenbereich, und sie hat bei zahlreichen Branchen-Transaktionen mitgewirkt. Franziska verbindet fundierte juristische Expertise mit Führungserfahrung aus börsennotierten, internationalen Cannabisunternehmen. Vor ihrem Eintritt bei Oppenhoff als Rechtsanwältin war sie als President Europe und Chief Legal Officer tätig und wirkte am Aufbau sowie an der Skalierung europäischer Aktivitäten mit.
Disclaimer: Gastbeiträge müssen nicht die Meinung der Redaktion widerspiegeln.