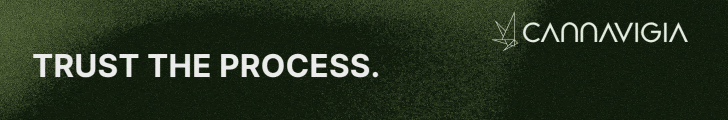Aktuell scheint die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) der Reihe nach Anträge für Cannabis-Modellprojekte abzulehnen. Anfang November meldete der Tagesspiegel, dass auch die Anträge für das Vorhaben in drei Berliner Bezirken vor dem Aus steht. Nun hat die BLE zwar eine vorläufige Stellungnahme veröffentlicht, um ihre Sicht auf die Forschungsklausel zu schildern. Diese wirft allerdings umso mehr die Frage auf, ob die BLE überhaupt gewillt ist, aktuell einen Antrag mit Fachgeschäften zu bewilligen – und nach dem grundsätzlichen Sinn und Zweck der Klausel.
Da die Ampel-Regierung für Säule zwei kein eigenes Gesetz verabschiedet hat, verweist die BLE im Wesentlichen analog zum KCanG auf „die rechtlichen Anforderungen gemäß § 2 Abs. 4 Konsumcannabisgesetz“. Eine Anfrage von krautinvest.de zu den Kriterien, anhand derer Sachbearbeiter schlussendlich darüber entscheiden, ob ein Antrag für ein Cannabis-Modellprojekt bewilligt oder abgelehnt wird, beantwortet die BLE mit Verweis auf „laufende juristische Verfahren“ nicht. Unter anderem die Sanity Group hat bereits angekündigt, den Rechtsweg zumindest in Betracht zu ziehen. Die aktuelle Formulierung der BLE legt nun nahe, dass erste Antragsteller den Klageweg bereits beschritten haben.
In der kürzlich veröffentlichten Stellungnahme erörtert die BLE dafür ausgiebig, was ihres Erachtens im Rahmen der Forschungsklausel möglich ist, was nicht – und begründet ihre Sichtweise. Dem von der CSU geführten Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) räumt sie dabe eine „gewisse Steuerungsmöglichkeit“ ein. Nach allem, was man vernimmt, soll das Ministerium aber ohnehin nicht die bisherigen Ablehnungen der Anträge herbeigeführt haben.
Vielmehr betont die BLE, dass eine „Umsetzung der zweiten Säule der Cannabislegalisierung über die Forschungsklausel nicht möglich“ scheint. Schließlich ließe sich über die Forschungsklausel „keine wissenschaftliche Grundlage für eine dauerhafte rechtliche Implementierung einer kommerziellen Cannabis-Lieferkette in Deutschland schaffen.“ Genau um solch einen Schritt schlussendlich zu rechtfertigen, sollte durch die zweite Säule unter anderem im Vorfeld erforscht werden, inwiefern davon der Kinder-, Jugend- und Gesundheitsschutz profitieren können. Doch die Ampel-Regierung zerbrach, bevor sie die zweite Säule per Gesetz auf die Strecke brachte. Es kam zur Verordnung, die die BLE zur zuständigen Behörde für Anträge zur Forschung an Konsum-Cannabis ernannte. Aber was ist im Rahmen dieser Verordnung überhaupt möglich?
Mindestens in einem Antrag hat die BLE einen sehr grundsätzlichen Ablehnungsgrund angegeben. Dort heißt es: „Der Anwendungsbereich der im Konsumcannabisgesetz (KCanG) enthaltenen Forschungsklausel (§ 2 Abs. 4) ist nicht eröffnet, es handelt sich im Kern um Modellprojekte der sogenannten ‚Säule 2‘.“ Dies wirft die Frage auf, ab wann ein Modellprojekt überhaupt im Rahmen des KCanGs durch die BLE bewilligt werden kann, weil es aus Sicht der BLE eben nicht unter die ‚Säule 2‘ fällt.
Für eine sicher Umsetzung der zweiten Säule, argumentiert die BLE, bedürfe es spezieller Regelungen per Gesetz, das die Ampel aber nie fertiggestellt geschweige denn verabschiedet hat. Die BLE selbst sieht sich nicht ermächtigt, beispielsweise die Anzahl der Cannabis-Fachgeschäfte entsprechend der Bevölkerung in den Regionen zu begrenzen oder zu definieren, welche Teilnehmer:innen bestimmter Regionen auszuschließen seien. Zudem geht die BLE aktuell davon aus, dass sowohl für jeden Akteur in der Lieferkette als auch für jeden Probanden Einzelerlaubnisse erteilt werden müssten – dies wiederum widerspreche dem Ausnahmecharakter der Forschungsklausel.
Umso mehr stellt sich die Frage: Wieso hat die Ampel-Regierung die Forschungsklausel überhaupt erlassen, wenn Forschung rund um Konsumcannabis dadurch gar nicht möglich wird?
Erlassen hat die Verordnung unter der Ampel-Regierung noch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Der damalige SPD-Abgeordnete Dirk Heidenblut sagte im November 2024 Bundestag: „Auf jeden Fall muss die Forschungsklausel jetzt noch umgesetzt werden, damit die Unternehmen, damit die Städte, die schon in den Startlöchern stehen – wie Hannover, wie Frankfurt –, eine Chance haben, schon mal die Legalisierung auszuprobieren, Modellvorhaben auf den Weg zu bringen.“ Und das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, damals noch unter Federführung des Grünen Ministers Cem Özdemir, teilte angesichts der erlassenen Verordnung, die die BLE zur zuständigen Behörde ernannte, im Dezember 2024 mit: „Forschung an und mit Konsumcannabis ist daher ab jetzt wieder möglich, aber erlaubnispflichtig.“
Linda Heitmann, für die Grünen Mitglied im Gesundheitsausschuss, bewertet eine vergleichsweise grundsätzliche Ablehnung von Modellprojekten durch die BLE gegenüber krautinvest.de daher kritisch: „Bei der damaligen Gesetzgebung und der nachgelagerten Verordnung wurde explizit dafür plädiert, dass wissenschaftliche Forschung an und mit Konsumcannabis möglich sein sollte, und die BLE wurde dafür als zuständige Behörde per Verordnung bestimmt, um entsprechende Vorhaben zu genehmigen und in der Folge zu begleiten.“ Ihres Erachtens erscheint die Forschungsklausel „als tragfähige Rechtsgrundlage für die Genehmigung wissenschaftlicher Modellprojekte – natürlich vorausgesetzt, die Projekte sind wissenschaftlich konzipiert, räumlich und zeitlich begrenzt und dienen der Gewinnung von Erkenntnissen zu Konsum, Gesundheitsschutz und Prävention.“ Heitmann geht davon aus, dass die „damalige ministerielle Intention“ sehr wohl in der Lage war, „Forschung zur räumlich und zeitlich begrenzten Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken auch jenseits der noch nicht verabschiedeten ‚Säule II‘-Gesetzgebung und auf Basis der ‚Säule I‘ zu ermöglichen.“
Dies liest sich in der aktuellen Stellungnahme der BLE nun anders. Immerhin in einem Punkt sorgt die Behörde für Klarheit: Ihrerseits könne sie beispielsweise Forschung zu Anbauversuchen, dem Einsatz von KI im Anbau, zur Untersuchung verschiedener Konsumformen, zu Fragen rund um die Extraktion, Lagerung, Haltbarkeit oder Verpackungsformen im Rahmen der Verordnung bewilligen. K.O.-Kriterien seien dagegen Fachgeschäfte oder auch mehrere über eine Lieferkette verbundene Betriebsstätten.